»Du bist wieder in einem kritischen Zustand«, sagt mein Mitbewohner und plinst von der andern Sofaecke misstrauisch zu mir rüber.
Während der Pandemie arbeiten wir uns durchs Survivalfilmgenre. Die Streamingplattformen überbieten sich dieser Tage damit, Filme über die Endzeit boomen, während die Wirtschaft schwächelt und die Nachrichten apokalyptisch anmuten.
Ein paar Tage zuvor habe ich mit dem Mitbewohner über den Film Arctic gestritten. Mir ging das Schicksal des Piloten, gespielt von Mads Mikkelsen, dessen Flugzeug in einer vereisten, verschneiten Bergregion strandet, nicht nah genug. Der Film setzte unvermittelt ein, mit der Figur der Frau, die er auf einem selbstgebauten Schlitten durch die Kälte zerrt, wurde ich nicht warm. Die obligatorische Bärenbegegnung war weniger eindrücklich als die mit dessen Artgenossen in The Revenant . Der Weg zum Rettungspunkt, wie Mats die Verletzte über die Schneedecke zog, der Einbruch in die Höhle, die Befreiung daraus – bis zum Schluss für mich nur eine krampfige Aneinanderreihung von Ereignissen, als hätte sich das Filmteam zusammengesetzt und überlegt: »Und jetzt, was könnte jetzt denn bloß noch passieren?« Es kam bei mir einfach keine Spannung auf.
Nach dem Abspann hatte ich dann eben einen Rappel bekommen, weil der Mitbewohner den Film großartig fand und ich nicht verstand, wieso.
Jetzt, ein paar Tage später, sitzen wir auf dem Sofa, es läuft der Abspann von Ad Astra .
»Alles in Ordnung«, sage ich eingedenk der letzten Survivalstreiterei. »Dufter Film.«
»Ich seh genau, dass du in einem kritischen Zustand bist.«
Soll ich ihm sagen, der Film ist wie ein Rendezvous mit Joe Black im Weltall? Ende der Neunziger hatte mich dieser Pitt-Streifen das Gähnen gelehrt.
Auch in Ad Astra ist der rote Faden eher blassrosa, auf dem Mond gibt’s Piraten, die grundlos Astronauten verfolgen, im Weltall greifen einen wütende Affen an – und nichts davon zahlt auf die eigentliche Geschichte ein: die der verzweifelten Suche eines Sohnes nach seinem Vater.
Ich kann es nicht länger für mich behalten und starte die Kritikrakete mit Getöse. Alles, was mir an Figuren und Plot missfiel, schieße ich ihm wortreich entgegen.
Der Mitbewohner hört sich das an und nickt bedächtig.
»Ich zeig dir mal, wie wir deinen kritischen Zustand beenden können«, sagt er, steht auf und kommt mit einem Holzbrettchen aus zurück, das seinen Platz normalerweise im Küchenregal hat.
Er schiebt das Brettchen auf den Tisch vor mich, ergreift meine Hand und legt sie darauf, spreizt meine Finger ein wenig.
Dann ergreift er den Fleischhammer aus Holz, den wir sonst nie benutzen. In unserer Küche wird selten Tier zubereitet, für mich sowieso nicht und für ihn nicht mehr, seitdem er neulich Cowspiracy gesehen hat. Ein Film, an dem ich ausnahmsweise nichts auszusetzen habe.
Der Mitbewohner hebt den Hammer und tut so, als wollte er ihn auf meine Hand niedersausen lassen, haut aber mit Absicht voll daneben. Ich erschrecke mich, muss aber lachen, und das beendet meinen kritischen Zustand.
Das Brett ist eindrucksvoller als Brad. Oder anders gesagt: Die Gegenwart ist eindrucksvoller als alles, was sich auf der Leinwand abspielt. Künftig skippe ich die fiktiven Survivaldramen. Die Welt ist in einem kritischen Zustand, da muss ich es nicht auch noch sein.
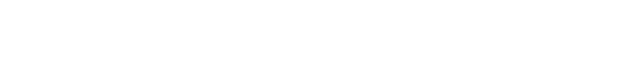

0 Kommentare