Der Kumpel und ich wohnen inzwischen eine Weile zusammen, der Gesprächsstoff geht uns selten aus. Das liegt vermutlich daran, dass wir beide mit Sprache arbeiten, er als Übersetzer, ich als Autorin.
„Hast du eigentlich ein Lieblingswort?«, frage ich, während wir Pellkartoffeln mit Sojaquark essen, und denke an so was wie putzwunderlich, zaubertrunken oder spornstreichs.
»Nein«, sagt der Mitbewohner.
»Wirklich nicht?«
»Doch.« Er grinst. »Nein ist mein Lieblingswort, seit ich drei war.«
»Und warum?«, will ich wissen.
»Weil es das wichtigste Wort ist.«
»Quatsch«, sage ich. »Da gibt’s bestimmt wichtigere.«
»Nein«, sagt er.
Ich gebe auf.
Erst einige Tage später wird mir klar, was er gemeint hat.
»Der Waffelhase kann nicht bei den Monstern hängen«, sagt er im Brustton der Überzeugung.
Klingt, als hätte er den Verstand verloren.
Verblüffenderweise ergibt jedes Wort Sinn.
Ich will ein Bild der Multimediakünstlerin Miranda July aufhängen. Es zeigt ein Kaninchen, das eine belgische Waffel auf dem Kopf trägt. Meine Schwester hat es mir vor Jahren geschenkt, es bringt mich immer zum Lachen. Also gehört es zu den wenigen Dingen, die ich auch als Minimalistin noch besitze.
»Aber ich will das Häschen hier aufhängen!«
»Du spinnst wohl«, sagt er, und ich muss lachen, weil er dabei so lieb guckt. »Das passt hier nicht hin.«
Eingeschlagen habe ich den Nagel für das Bild neben seiner Galerie von Fabelwesen: eins flauschig mit vielen Zähnen, ein anderes mit Tentakeln, wieder eines mit drei Augen, ein weiteres ohne.
Ich finde, das Waffelhäschen ist ebenso kurios wie die Monster, und hänge es kurzerhand an den Nagel.
»Da passt es doch gut hin«, sagte ich und betrachtete es zufrieden.
»Nein.« Er schüttelt den Kopf.
»Wie, nein?« Ich sehe ihn entgeistert an.
»Das passt nicht.«
»Aber es ist mein Lieblingsbild!«
»Nein, das geht nicht.«
Egal, wie heftig ich das Häschen anpreise, es bleibt dabei.
Nach einer Weile gebe ich auf und trotte in mein Zimmer, wo ich das Bild vorerst an die Wand lehne.
Als ich wieder ins Wohnzimmer komme, sitzt er auf dem Sofa und betrachtet zufrieden seine häschenfreie Monstergalerie.
In den nächsten Wochen wird mir etwas klar: Er meint es ernst, nein ist wirklich sein Lieblingswort. Nicht, weil er es oft verwendet, sondern weil er es in den richtigen Augenblicken tut. Wenn jemand seinen Zeitplan durcheinanderbringt. Wenn er von der Sinnhaftigkeit einer Sache nicht überzeugt ist. Wenn er etwas tun soll, das er partout nicht mag.
Wie Sonntagssport – während der Coronazeit habe ich eingeführt, dass wir jeden Morgen Fitnessgymnastik im Wohnzimmer veranstalten. Das findet er grundsätzlich gut. Aber eben nicht am Sonntag.
Übelnehmen kann ich es ihm nicht, weil er die Gründe für seine Ablehnung detailliert – manchmal zu detailliert – darlegt. Und bei aller Erklärung guckt er immer so grundzufrieden oder so ernsthaft, dass ich ihm einfach nicht böse sein kann.
Und ein merkwürdiges Gefühl macht sich im Lauf der Zeit in mir breit.
Ich bin neidisch.
Er ist ein exzellenter Neinsager.
Ich hingegen bin ein Neinversager.
Ich mache zu oft Zugeständnisse oder lasse mich breitschlagen, selbst wenn mir das hektische Flecken vor lauter Stress oder Bauchgrimmen wegen meiner inneren Ablehnung verursacht.
Ich sage nicht nein, wenn mir jemand ein arbeitsintensives Projekt anvertraut, für das ich keine Zeit habe.
Ich sage nicht nein zur Hilfsorganisation, die mir abends noch zehn Seiten schickt, die dringend für den Newsletter zum nächsten Tag aus dem Spanischen übersetzt werden sollen.
Und ich sage nicht nein zur Freundin, die mir alles – von Bewerbungsunterlagen über Beschwerdebriefe bis zur Botschaft an die Schwiegermutter – zur Rechtschreibkorrektur schickt.
Zu blöd.
Denn nicht nein nicht sagen zu können, bedeutet ja zu sagen: zu unangenehmen Arbeiten, die andere Leute selbst erledigen müssten. Ja zu Sachen, die ich gar nicht brauche. Ja dazu, dass jemand meine Lebensentscheidungen trifft. Kurz: Dass ich etwas tue, das ich gar nicht tun will.
Und warum?
Um gemocht zu werden. Um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Weil ich ein hilfsbereiter Mensch bin und nicht herzlos wirken möchte. Und ja, ich mag es, gebraucht zu werden. Ich will eingeschlossen werden, möchte dazugehören, nichts verpassen. Also mache ich viel zu oft etwas, das mich in eine Bredouille bringt. Das mir Stress verursacht. Für Zeitdruck sorgt.
Natürlich tue ich gern was für andere. Aber indem ich ja zu ihren Projekten sage, sage ich automatisch nein zu meinen eigenen. Wenn ich mich künftig entscheide, meine Zeit zu geben, dann nur, weil ich dieses Zeitgeschenk für wichtig halte.
Und dafür muss ich nein sagen lernen.
Ich übe es wie die Gymnastik mit dem Mitbewohner an den Wochentagen. Es sind Übungen für jede Stimmungslage. Höflich: Ich kann nicht, aber danke fürs Angebot!, Da muss ich leider passen und Ich fürchte, das geht nicht. Salopp: Mein Terminkalender platzt aus allen Nähten. Freundlich: Diesmal geht’s leider nicht oder Vielleicht ein andermal. Schlicht und ergreifend: Das geht nicht oder Ich kann nicht. Ich werde immer übermütiger: Dazu habe ich keine Lust, Das geht gar nicht und Auf gar keinen Fall! Und schnöde: Nö.
Ich nehme mir Bedenkzeit, bevor ich zusage, etwas zu tun. Überlege, ob es mir Zeit für eigene Projekte klaut. Mich stresst. Ob ich es wahrhaftig erledigen möchte.
Und ich gucke mir vom Mitbewohner ab, wie ich nein sage:
Ich bedanke mich für das Vertrauen. Ich begründe, warum ich etwas nicht tun kann. Ich mache einen Vorschlag, wie die Sache ohne mich gelöst werden kann. Ich sage es so, dass die andere Person es versteht, einen eigenen Weg findet, lachen muss.
Nein sagen zu können, wenn ich etwas nicht will, fühlt sich gut an. Es ist eine echte Erleichterung.
»Bereust du es eigentlich, eingezogen zu sein?«, fragt mich der Mitbewohner, als wir zusammen auf dem Sofa sitzen und den Blick über die Monster wandern lassen. »Wegen des Häschens?«
»Nein«, sage ich. »Nope. Nö. Gar nicht.«
Es ist nicht mein Lieblingswort.
Aber es ist auf jeden Fall sehr weit oben in den Charts.
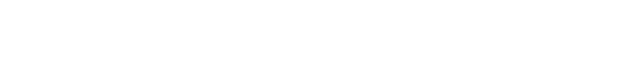

0 Kommentare